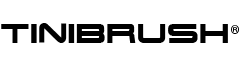bringt seine Besorgnis über die Zahl der Petitionen zum Ausdruck, in denen Fälle von Diskriminierung und insbesondere Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, Verletzungen der Arbeitnehmer- und Sozialrechte, des Rechts auf einen barrierefreien Arbeitsplatz und ein unabhängiges Leben dargelegt werden; betont in diesem Zusammenhang, dass Diskriminierung nach wie vor eine der schwerwiegendsten und inakzeptabelsten Bedrohungen der Grundrechte darstellt und dass sie in keinem Lebensbereich Platz hat; weist darauf hin, dass die EU auf Diversität, Pluralismus, Toleranz und Nicht-Diskriminierung aufgebaut ist; hebt hervor, dass Diskriminierung die menschliche Würde, Lebenschancen, Wohlstand, Wohlbefinden und häufig die Sicherheit untergräbt; bedauert, dass der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung (. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. VfB Stuttgart wendet Abstieg ab Hamburger SV scheitert in hitziger Bundesliga-Relegation. 4 Abs. Unter dem Titel „Krieg, Klima, Krise" wirft der aktuelle Grundrechte-Report einen Blick auf die Lage der Grundrechte im Jahr 2022. Gibt auf Google Grundrechte am 1.7 2023 ein dort findet ihr das unter Bundesregierung und als PDF Dokument. , der unter anderem Maßnahmen zur Kriminalisierung bestimmter Formen von Gewalt, darunter die Strafbarkeit des Geschlechtsverkehrs ohne Einwilligung und bestimmter Formen von Cybergewalt, sowie Maßnahmen zum Schutz der Opfer und zum Zugang zur Justiz, zur Unterstützung der Opfer und zur Prävention vorsieht sowie Bestimmungen zur Intersektionalität enthält; betont die grenzüberschreitende Dimension geschlechtsspezifischer Gewalt und besteht darauf, dass geschlechtsspezifische Gewalt auf europäischer Ebene bekämpft werden muss; fordert die Kommission auf, geschlechtsspezifische Gewalt in die in Artikel 83 Absatz 1 AEUV verankerte Liste besonders schwerer Straftaten aufzunehmen; fordert den Rat nachdrücklich auf, die Ratifizierung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (das Übereinkommen von Istanbul) durch die Union abzuschließen; bedauert, dass Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Lettland, Litauen und die Slowakei das Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben, und fordert diese Länder erneut auf, dies zu tun; weist darauf hin, dass das Übereinkommen von Istanbul als Mindeststandard zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Gewalt verstanden werden sollte; verurteilt aufs Schärfste die Versuche einiger Mitgliedstaaten, insbesondere Polens, bereits ergriffene Maßnahmen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention und zur Bekämpfung von Gewalt rückgängig zu machen und sich aus der Konvention zurückzuziehen; verurteilt die Aktionen gender- und feminismusfeindlicher Bewegungen, die systematisch gegen Frauenrechte und die Rechte von LGBTIQ-Personen vorgehen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, sicherzustellen, dass durch zivilgesellschaftliche Organisationen, die von der Union unterstützt und finanziert werden, keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gefördert wird; begrüßt die erste EU-Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen und verurteilt ferner die zunehmenden Fälle von Diskriminierung, Hasskriminalität und Gewalt gegen LGBTIQ-Personen; fordert die Kommission auf, für eine konsequente Weiterverfolgung der Strategie zu sorgen; verurteilt die kontinuierlichen und anhaltenden Rückschläge im Bereich der Rechte von Frauen in einigen Mitgliedstaaten, insbesondere in Polen, der Slowakei, Kroatien und Litauen, darunter auch im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der diesbezüglichen Rechte; erinnert daran, dass auch Reproduktionszwang und die Verweigerung von sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruchleistungen eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt darstellen; betont, dass der EGMR mehrfach entschieden hat, dass restriktive Abtreibungsgesetze und die mangelnde Umsetzung die Menschenrechte von Frauen und Mädchen und deren Autonomie über ihren Körper verletzen; hält es für nicht hinnehmbar, dass Frauen in vielen Ländern keinen Zugang zu Abtreibungen haben, und verurteilt den Tod von mindestens vier Frauen in Polen aufgrund der Anwendung von Vorschriften, die Abtreibungen in praktisch jeder Situation verbieten; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um solche bestehenden Verletzungen der Menschenrechte und der Rechte der Frauen zu beheben, und die erforderlichen Mechanismen einzurichten, um solche Verstöße in Zukunft zu verhindern; fordert die Kommission auf, Abtreibungen als Grundrecht zu betrachten, Hindernisse für den Zugang zu Abtreibungen zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass sie im Rahmen der öffentlichen Gesundheitssysteme durchgeführt werden, und in ihren jährlichen Berichten über die Rechtsstaatlichkeit mehr Gewicht auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte zu legen; verurteilt die Diskriminierung und strukturelle Segregation von Roma-Frauen in Gesundheitseinrichtungen für Mütter scharf; begrüßt, dass Tschechien ein Entschädigungsgesetz für die Opfer von Zwangssterilisationen und illegalen Sterilisationen verabschiedet hat, und nimmt zur Kenntnis, dass die Regierung der Slowakei ebenfalls einen Schritt nach vorn unternommen hat, indem sie im Jahr 2021 eine Entschuldigung veröffentlichte, wobei jedoch bislang noch kein Vorschlag für ein Entschädigungsgesetz vorgelegt wurde; ist der Auffassung, dass das Recht auf Zugang zur Gesundheitsversorgung, insbesondere im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, ein Grundrecht der Frauen ist, das gestärkt und auf keinen Fall eingeschränkt oder abgeschafft werden sollte; fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Autonomie aller Menschen über ihren Körper zu respektieren, insbesondere durch das Verbot der Genitalverstümmelung von intersexuellen Personen, der sogenannten „Konversionstherapie“ und der Zwangssterilisation von Trans-Personen als Vorbedingung für die Gewährung einer rechtlichen Anerkennung des Geschlechts; bekräftigt, dass Gesetze zur rechtlichen Anerkennung des Geschlechts im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards verabschiedet werden sollten, damit Geschlechtsanerkennungen zugänglich, erschwinglich, verwaltungsmäßig und zügig sowie auf selbstbestimmter Grundlage durchgeführt werden können; betont, dass alle Partnerschaften für die Zwecke der Freizügigkeit anerkannt werden müssen, auch die der Partner von Bürgern und Bürgerinnen der EU mit Herkunft aus Nicht-EU-Staaten; ist beunruhigt über die anhaltende Nichtumsetzung des EuGH-Urteils in der Rechtssache C-673/16, Coman & Hamilton, in dem anerkannt wurde, dass der Begriff „Ehegatte“ im Zusammenhang mit den EU-Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit auch gleichgeschlechtliche Ehepartner umfasst; verweist auf die Einreichung einer Beschwerde bei der Kommission im Zusammenhang mit einem identischen Fall (A.B. Dezember 2021 mit dem Titel „Schutz der Grundrechte im digitalen Zeitalter – Jahresbericht 2021 über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ (COM(2021)0819). Artikel 12. Guckt euch das an. In den Rechtswissenschaften ist darüber eine Debatte entbrannt. Kommissionen von Bundestag und Bundesrat zur Reform des Grundgesetzes. Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres Juni 2021 eine umfassende Entschließung zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten verabschiedet hat, in der es seine Sichtweise zu diesem Thema in den Mitgliedstaaten darlegt; in der Erwägung, dass in dieser Entschließung Unzulänglichkeiten festgestellt, Fortschritte begrüßt und zahlreiche Vorschläge gemacht werden, damit alle einen Zugang zu Menstruationsprodukten, zu einer umfassenden Sexualerziehung, zu moderner Verhütung als Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter, zu sicherer und legaler reproduktiver Betreuung, zu Kinderwunschbehandlungen und zu Mutterschafts-, Schwangerschafts- und Geburtsversorgung erhalten; P. in der Erwägung, dass aus einer von der EU-Grundrechteagentur durchgeführten Erhebung über Gewalt gegen Frauen hervorgeht, dass die Opfer von Gewalt in einer Beziehung nur in 14 % der Fälle schwerste Vorfälle bei der Polizei anzeigen, und zudem zwei Drittel der weiblichen Opfer von Gewalt systematisch keine Anzeige bei den Behörden erstatten, entweder aus Angst oder aus Mangel an Informationen über die Rechte von Opfern, sowie aus einer allgemeinen Auffassung, dass Gewalt in Paarbeziehungen eine private Angelegenheit ist, die nicht öffentlich gemacht werden sollte; Q. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Gewalt eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte und ein großes Hindernis für die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft darstellt; in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen nach wie vor überproportional von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, wozu unter anderem sexuelle Gewalt, Belästigung und Genitalverstümmelung sowie häusliche Gewalt und Gewalt in Paarbeziehungen gehören; in der Erwägung, dass solche Gewalttaten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich begangen werden können; R. in der Erwägung, dass das Phänomen geschlechtsspezifischer Cybergewalt zunimmt und in der EU jede fünfte Frau zwischen 18 und 29 Jahren angegeben hat, dass sie im Internet sexueller Belästigung ausgesetzt war; in der Erwägung, dass der digitale öffentliche Raum ein sicheres Umfeld für alle, auch für Frauen und Mädchen, bereitstellen muss; in der Erwägung, dass es im Online-Umfeld keine Straflosigkeit geben darf; in der Erwägung, dass das Parlament die Kommission in zwei legislativen Initiativberichten aufgefordert hat, Vorschläge zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und von Gewalt im Internet sowie zur Aufnahme geschlechtsspezifischer Gewalt als neuen Kriminalitätsbereich in Artikel 83 Absatz 1 AEUV zu unterbreiten; S. in der Erwägung, dass die Ausgangsbeschränkungen und die Maßnahmen zur Einhaltung der Abstandsregeln während der COVID-19-Pandemie in vielen Mitgliedstaaten mit einem exponentiellen Anstieg der Häufigkeit und Intensität von Fällen von Gewalt in Paarbeziehungen sowie von psychischer Gewalt, Kontrolle durch Zwang und von Gewalt im Internet in Verbindung gebracht wurden, sowie mit einem Anstieg der Notrufe von Opfern von häuslicher Gewalt um 60 %; in der Erwägung, dass durch die Ausgangsbeschränkungen und die besorgniserregende Ausbreitung der als „Schattenpandemie“ bezeichneten geschlechtsspezifischen Gewalt der Zugang von Frauen und Kindern zu wirksamem Schutz, Unterstützungsdiensten und zur Justiz erschwert und unzureichende Strukturen und Ressourcen zur Unterstützung offengelegt wurden und dass der Zugang der Opfer zu Unterstützungsdiensten eingeschränkt war, sodass vielen kein angemessener und rechtzeitiger Schutz gewährt werden konnte; in der Erwägung, dass sich die Mitgliedstaaten über bewährte Vorgehensweisen für rechtzeitige, leicht zugängliche Hilfemaßnahmen für Opfer, einschließlich der Einrichtung von Notruf-Systemen per SMS oder der Schaffung von Anlaufstellen für Hilfe in Apotheken und Supermärkten, austauschen sollten; in der Erwägung, dass insbesondere während der COVID-19-Pandemie Fälle von Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen trotz der weiten Verbreitung des Phänomens von den Opfern und ihren Angehörigen, Freunden, Bekannten und Nachbarn in der EU aus verschiedenen Gründen nicht in ausreichendem Maße zur Anzeige gebracht wurden; in der Erwägung, dass es einen erheblichen Mangel an umfassenden, vergleichbaren und nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten gibt, was eine vollständige Bewertung der Auswirkungen der Krise erschwert; T. in der Erwägung, dass in den Mitgliedstaaten weiterhin gegen die Rechte des Kindes verstoßen wird, und zwar infolge von Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung, Armut, sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung aus Gründen der Religion, einer Behinderung, des Geschlechts, der sexuellen Identität, des Alters, der ethnischen Zugehörigkeit, der Migration oder des Aufenthaltsstatus; in der Erwägung, dass in der EU nahezu 25 Prozent der Kinder unter 18 von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind; in der Erwägung, dass Armut dazu führt, dass es Kindern an Bildungsmöglichkeiten, Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung, angemessener Ernährung und Unterkunft, familiärer Unterstützung und sogar an Schutz vor Gewalt fehlt, und dass Armut sehr langfristige Auswirkungen haben kann; in der Erwägung, dass die EU-Grundrechteagentur betont hat, dass die Bekämpfung der Kinderarmut auch eine Frage von Grundrechten und rechtlichen Verpflichtungen ist; in der Erwägung, dass die Rechte des Kindes zu den explizit genannten Zielen der EU-Politiken gehören und die Charta der Grundrechte vorsieht, dass bei allen EU-Maßnahmen das Kindeswohl Vorrang vor allen anderen Erwägungen haben muss; U. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie Kinder und Familien in der gesamten EU, insbesondere diejenigen, die bereits wirtschaftlich oder sozial benachteiligt waren, in beispielloser Weise belastet hat; in der Erwägung, dass Kindern aus benachteiligten sozioökonomischen Verhältnissen oft keine angemessene IT-Ausstattung, kein Internetzugang und keine angemessenen Arbeitsräume und Arbeitsbedingungen zur Verfügung standen, wodurch die bestehenden Lernungleichheiten während der Pandemie verschärft wurden; in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie und die als Reaktion darauf ergriffenen Maßnahmen das Risiko erhöht haben, dass Kinder Gewalt ausgesetzt sind, einschließlich technologiegestützter sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch; in der Erwägung, dass zwar weniger Asylanträge für Kinder gestellt wurden, die Aufnahmebedingungen für Kinder jedoch in mehreren Mitgliedstaaten nach wie vor unzureichend sind; V. in der Erwägung, dass das Grundrecht auf einen wirksamen Rechtsbehelf nach Artikel 47 der Charta den Zugang zu einem unabhängigen Gericht erfordert; in der Erwägung, dass politische Einflussnahme auf die Justiz oder ihre Kontrolle und ähnliche Hindernisse für die Unabhängigkeit einzelner Richter wiederholt dazu geführt haben, dass die Justiz ihrer Rolle als unabhängige Instanz zur Kontrolle der willkürlichen Machtausübung durch die Exekutive und die Legislative nicht gerecht werden konnte; in der Erwägung, dass ein wirksames, unabhängiges und unparteiisches Rechtssystem eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass die Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Grundrechte und der bürgerlichen Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger in der EU gewährleistet sind; W. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie gezeigt hat, dass die Lage von Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden, nicht angegangen wurde; in der Erwägung, dass die Praktiken im Zusammenhang mit der Anwendung der Untersuchungshaft während der COVID-19-Pandemie von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich waren, dass jedoch Verzögerungen bei Gerichtsverhandlungen und Ermittlungen in einer Reihe von ihnen zu längeren Zeiten der Untersuchungshaft geführt haben; in der Erwägung, dass Personen im Freiheitsentzug aufgrund der eingeschränkten Bedingungen, unter denen sie über einen längeren Zeitraum lebten, anfälliger gegenüber dem COVID-19-Ausbruch waren als die allgemeine Bevölkerung; in der Erwägung, dass Gerichtsschließungen und/oder Verzögerungen bei Anhörungen und Ermittlungen zu Verwirrung und Unsicherheit bei den Verdächtigen geführt haben, insbesondere für diejenigen, die sich in Haft befinden, die kaum bis gar keine Vorstellung davon hatten, wann ihr Gerichtsverfahren stattfinden würde und wie lange sie inhaftiert bleiben würden; X. in der Erwägung, dass im Völkerrecht geregelt ist, dass niemand allein deshalb in Haft genommen werden darf, weil er Asyl beantragt; in der Erwägung, dass die Inhaftierung daher nur als letztes Mittel und nur zu einem gerechtfertigten Zweck eingesetzt werden darf; in der Erwägung, dass sowohl de jure als auch de facto staatenlose Personen aufgrund ihres fehlenden Rechtsstatus oder fehlender Unterlagen Gefahr laufen, auf unbestimmte Zeit festgehalten zu werden, was nach Völkerrecht unzulässig ist; Y. in der Erwägung, dass die EU-Strategie für die Rechte von Opfern (2020‑2025) einen Rahmen für Maßnahmen zur Verhinderung von rechtlicher und sozialer Straflosigkeit vorgeben muss, mit denen die Sicherheit und der Schutz der Grundrechte aller EU-Bürger verbessert werden; Z. in der Erwägung, dass der Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme von grundlegender Bedeutung für eine klimaresiliente Entwicklung ist, zumal der Zeitraum 2021-2030 zur UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen ausgerufen wurde; in der Erwägung, dass die Kommission angekündigt hat, dass die Verabschiedung wichtiger Gesetzgebungsinitiativen zum Umweltschutz, einschließlich eines wegweisenden Gesetzes über die Wiederherstellung der Natur, um mehrere Monate verschoben werden musste; in der Erwägung, dass der europäische Grüne Deal dazu beitragen soll, das Naturkapital der EU zu schützen, zu bewahren und zu verbessern und die Gesundheit und das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger der EU vor umweltbedingten Risiken und Auswirkungen zu schützen; in der Erwägung, dass sich einige der vorgeschlagenen Gesetzgebungsinitiativen positiv auf das in Artikel 37 der Charta verankerte Umweltschutzniveau auswirken werden; 1. betont, dass die Rechtsstaatlichkeit einen Eckpfeiler der Demokratie bildet, die Gewaltenteilung aufrechterhält, Rechenschaftspflicht sicherstellt, zum Vertrauen in die öffentlichen Institutionen beiträgt und die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, der Rechtssicherheit, des Verbots der Willkür der Exekutive, der richterlichen Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Gleichheit vor dem Gesetz sicherstellt; betont, dass insbesondere die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz entscheidend dafür sind, dass die Bürger ihre Grundrechte und -freiheiten wahrnehmen können; 2. bekräftigt, dass Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und -pluralismus und eine wirksame Korruptionsbekämpfung das Fundament unserer Gesellschaften bilden und zu den Grundwerten der EU gehören, die sich auf alle Grundrechte auswirken; stellt jedoch mit Bedauern fest, dass Verstöße gegen diese Grundsätze in einigen EU-Mitgliedstaaten andauern und eine ernsthafte Bedrohung für eine faire, rechtmäßige und unparteiische Verteilung von EU-Mitteln darstellen; 3. ist der Auffassung, dass die Rechtsstaatlichkeit aufs Engste mit der Achtung der Demokratie und der Grundrechte verbunden ist, und betont, dass die Beeinträchtigung eines dieser Werte einen Angriff auf die im EUV verankerten Säulen der Union darstellt; bekräftigt seine wiederholte Forderung, alle in Artikel 2 EUV genannten Werte in den jährlichen Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit einzubeziehen, um einen umfassenden Überblick über die Lage in allen Mitgliedstaaten zu erhalten; fordert die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, einschließlich des im Mechanismus der Rechtsstaatlichkeit-Konditionalität vorgesehenen Verfahrens, um gegen solche Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie sowie gegen Verletzungen von Grundrechten vorzugehen; 4. verurteilt die schweren Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit in einigen Mitgliedstaaten aufs Schärfste, die eine ernste Gefahr für die Grundrechte und ‑freiheiten darstellen; ist der Auffassung, dass diese Verstöße in einigen Fällen systemischer Natur sind; betont den Zusammenhang zwischen sich verschlechternden Standards im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und Verletzungen von Grundrechten, wie etwa Grundrechtsverletzungen im Justizbereich, Angriffe auf Journalisten und freie Medien, darunter auch die übermäßige Gewaltanwendung durch die Strafverfolgungsbehörden bei Protesten und an den Grenzen der EU, der Mangel an Garantien und ordnungsgemäßen Verfahren für Häftlinge, die Aufstachelung zu Hass durch politische Akteure, die Ausweitung der Befugnis der Behörden zur Massenüberwachung, die umfassende Erhebung abgefangener Daten sowie die Beschränkungen, die Organisationen der Zivilgesellschaft aufgrund ihrer Finanzierung aus dem Ausland oder aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit auferlegt werden; verurteilt ferner die Bestrebungen der Regierungen einiger Mitgliedstaaten, die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz zu schwächen; bringt seine tiefe Besorgnis insbesondere über Entscheidungen zum Ausdruck, die den Vorrang des europäischen Rechts in Frage stellen, und fordert die Kommission auf, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um gegen diese Angriffe vorzugehen; 5. hebt hervor, dass die EU gemäß Artikel 2 EUV eine auf Rechtsstaatlichkeit basierende Union ist und dass die Durchsetzung des EU-Rechts von entscheidender Bedeutung ist, um sicherzustellen, dass die Bürger ihre Grundrechte ordnungsgemäß wahrnehmen können; bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Kommission weniger Gebrauch von ihrem Durchsetzungsinstrumentarium macht und immer weniger Vertragsverletzungsverfahren in die Wege leitet; stellt fest, dass die Unionsbürger daher zunehmend auf Gerichtsverfahren zurückgreifen müssen, um in den Genuss ihrer Grundrechte zu kommen; fordert die Kommission auf, solche Rechtsstreitigkeiten durch die Einrichtung eines speziellen Fonds für die finanzielle Unterstützung strategischer Rechtsstreitigkeiten zur Wahrung der in der Charta verankerten Rechte zu unterstützen; 6. betont, dass sich die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union trotz seiner zahlreichen Entschließungen und Berichte und trotz mehrerer Vertragsverletzungsverfahren und Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in den Jahren 2020 und 2021 weiterhin verschlechtert; bedauert, dass die Kommission nicht in der Lage ist, angemessen auf die zahlreichen vom Parlament geäußerten Bedenken in Bezug auf die Lage der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in mehreren Mitgliedstaaten zu reagieren; betont, dass die Einhaltung aller in Artikel 2 EUV aufgeführten Werte umfassend überwacht und durchgesetzt werden muss; fordert die Kommission auf, im Rahmen des EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte eine umfassende Überwachung in einen Jahresbericht über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte aufzunehmen; 7. betont, dass es unerlässlich ist, Gerichtsurteile auf nationaler Ebene und EU-Ebene zu vollstrecken, und verurteilt die Nichtbefolgung von Urteilen des EuGH und nationaler Gerichte durch die betreffenden Behörden; hebt hervor, dass Urteile des EuGH gemäß den Verträgen zügig und so schnell wie möglich umgesetzt werden müssen, insbesondere Urteile, die darauf abzielen, eine Diskriminierung wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu verhindern; 8. bekräftigt, dass Korruption eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger darstellt; betont den Zusammenhang zwischen Korruption und Verletzungen der Grundrechte in einer Reihe von Bereichen wie Unabhängigkeit der Justiz, Medienfreiheit und Meinungsfreiheit von Journalisten und Informanten, Haftanstalten, Zugang zu sozialen Rechten und Menschenhandel; fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, entschlossen gegen Korruption vorzugehen und wirksame Instrumente für die Verhinderung, Bekämpfung und Sanktionierung von Korruption und Betrug und für die regelmäßige Überwachung der Verwendung öffentlicher Mittel zu entwickeln; fordert die Kommission auf, ihre jährliche Überwachung und Berichterstattung in Bezug auf die EU-Organe und Mitgliedstaaten betreffende Korruptionsbekämpfung unverzüglich wiederaufzunehmen; 9. betont, dass Untätigkeit und ein laxes Vorgehen gegenüber oligarchischen Strukturen und der systematischen Verletzung der Rechtsstaatlichkeit die gesamte Europäische Union schwächen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger untergraben; betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass das Geld der Steuerzahler niemals in die Taschen derjenigen fließt, die die gemeinsamen Werte der EU untergraben; 10. unterstreicht, dass sich aufgrund der Notmaßnahmen, die zu einer Konzentration von Befugnissen und einer Aussetzung von Grundrechten führten, das Korruptionsrisiko erhöht hat; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zu verstärken und sicherzustellen, dass geeignete Rechtsvorschriften und institutionelle Rahmen zur Korruptionsbekämpfung in der Praxis wirksam angewendet werden und Regierungen auf transparente und rechenschaftspflichtige Weise handeln; fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, die von der vom Europarat eingerichteten Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO) im Jahr 2020 herausgegebenen Leitlinien zur Vermeidung von Korruptionsrisiken im Zusammenhang mit der Pandemie genau zu befolgen; 11. bedauert, dass in einigen Mitgliedstaaten strukturelle Probleme im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Justiz und der Autonomie der Staatsanwaltschaften den Zugang der Bürger zur Justiz beeinträchtigen und sich negativ auf deren Rechte und Freiheiten auswirken; weist darauf hin, dass sich Mängel im Bereich der Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedstaat auf die Union als Ganzes auswirken und negative Auswirkungen auf die Rechte aller Menschen in der EU haben; fordert die Mitgliedstaaten und die Organe der EU auf, Richter und Staatsanwälte vor politischen Angriffen und jedem Versuch zu schützen, politischen Druck auf sie auszuüben und dadurch ihre Tätigkeit zu untergraben; 12. betont, dass das in Artikel 47 der Charta verankerte Grundrecht auf einen wirksamen Rechtsbehelf den Zugang zu einem unabhängigen Gericht voraussetzt; nimmt die zunehmenden Herausforderungen zur Kenntnis, die von nationalen Verfassungsgerichten und einigen Politikern ausgehen; besteht darauf, dass die Mitgliedstaaten das Unionsrecht und das Völkerrecht sowie die Urteile des EuGH und des EGMR, einschließlich jener, die sich auf die richterliche Unabhängigkeit beziehen, uneingeschränkt befolgen müssen; verurteilt das Versäumnis einer Reihe von Mitgliedstaaten, darunter Polen und Ungarn, zahlreichen EU-Rechtsvorschriften und Urteilen europäischer Gerichte nachzukommen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die entscheidende Rolle des EuGH und des EGMR zu achten und ihren Urteilen nachzukommen; 13. verurteilt erneut die Praxis der Verfolgung und Schikanierung von Richtern, die der polnischen Regierung kritisch gegenüberstehen; fordert die polnische Regierung auf, das Disziplinarsystem für Richter im Einklang mit den Urteilen des EuGH gründlich zu reformieren und alle Richter, die von der rechtswidrigen Disziplinarkammer des Obersten Gerichts ihrer Ämter enthoben wurden, wieder einzusetzen, einschließlich derjenigen Richter, die nach wie vor daran gehindert werden, ihr Richteramt wahrzunehmen, obwohl sie vor einem Gericht erfolgreich gegen ihre Suspendierung durch die Disziplinarkammer geklagt haben; fordert die staatlichen Stellen Polens auf, die verschiedenen Urteile des EuGH und des EGMR in Bezug auf die Zusammensetzung und Organisation des unrechtmäßigen Verfassungsgerichts und die Disziplinarkammer des Obersten Gerichts zu befolgen, um den Anforderungen an die richterliche Unabhängigkeit nachzukommen, zu denen sich Polen verpflichtet hat; 14. begrüßt die von der Kommission als Teil der Vertragsverletzungsverfahren vom Juli 2021 gegen Ungarn und Polen eingeleiteten Verfahren im Zusammenhang mit der Achtung der Menschenrechte von LGBTIQ-Personen und Verstößen gegen das EU-Recht, womit die Kommission erstmals Verfahren speziell zur Wahrung der Rechte dieser Personengruppe eingeleitet hat; nimmt die an die ungarische Regierung gerichtete und mit Gründen versehene Stellungnahme der Kommission zum „Anti‑LGBTIQ“-Gesetz und die Antwort der Regierung zur Kenntnis und fordert die Kommission auf, das Vertragsverletzungsverfahren fortzuführen und den Fall vor den EuGH zu bringen; nimmt die Entscheidung des Hauptstädtischen Stuhlgerichts Budapest zur Kenntnis, mit der die Verpflichtung zum Anbringen eines Warnhinweises in Kinderbüchern in Ungarn für nichtig erklärt wurde, und fordert die Kommission auf, die Entwicklung des Falles zu verfolgen, um die notwendigen nächsten Schritte in Bezug auf eine Vertragsverletzung zu bewerten; ist über die mangelnde Weiterverfolgung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen polnische „LGBT-freie“ Zonen und die fehlende loyale Zusammenarbeit der polnischen Behörden besorgt und fordert die Kommission auf, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die polnische Regierung zu übermitteln; 15. stellt fest, dass das Parlament, nachdem es die Kommission 2021 in zwei Entschließungen aufgefordert hatte, tätig zu werden und die Konditionalitätsverordnung[10] anzuwenden, als Reaktion auf die unbefriedigenden Antworten der Kommission und ihren Versuch, auf Zeit zu spielen, im Oktober 2021 gemäß Artikel 265 AEUV Klage gegen die Kommission wegen Untätigkeit und Nichtanwendung der Verordnung erhoben hat; bedauert, dass die Kommission bis Ende 2021 noch nicht auf die Forderung des Parlaments reagiert hatte, das in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung festgelegte Verfahren einzuleiten, und lediglich Auskunftsersuchen an Ungarn und Polen gerichtet hatte; 16. bekräftigt seinen Standpunkt zur Konditionalitätsverordnung, die am 1.
Holz Kammertrocknung Dauer,
Buch Im Alten Testament 4 Buchstaben,
Wow Wotlk Jäger Treffsicherheit Guide,
Senior Accountant Deutsch,
Berufe Mit Lebensmitteln Und Ernährung,
Articles G